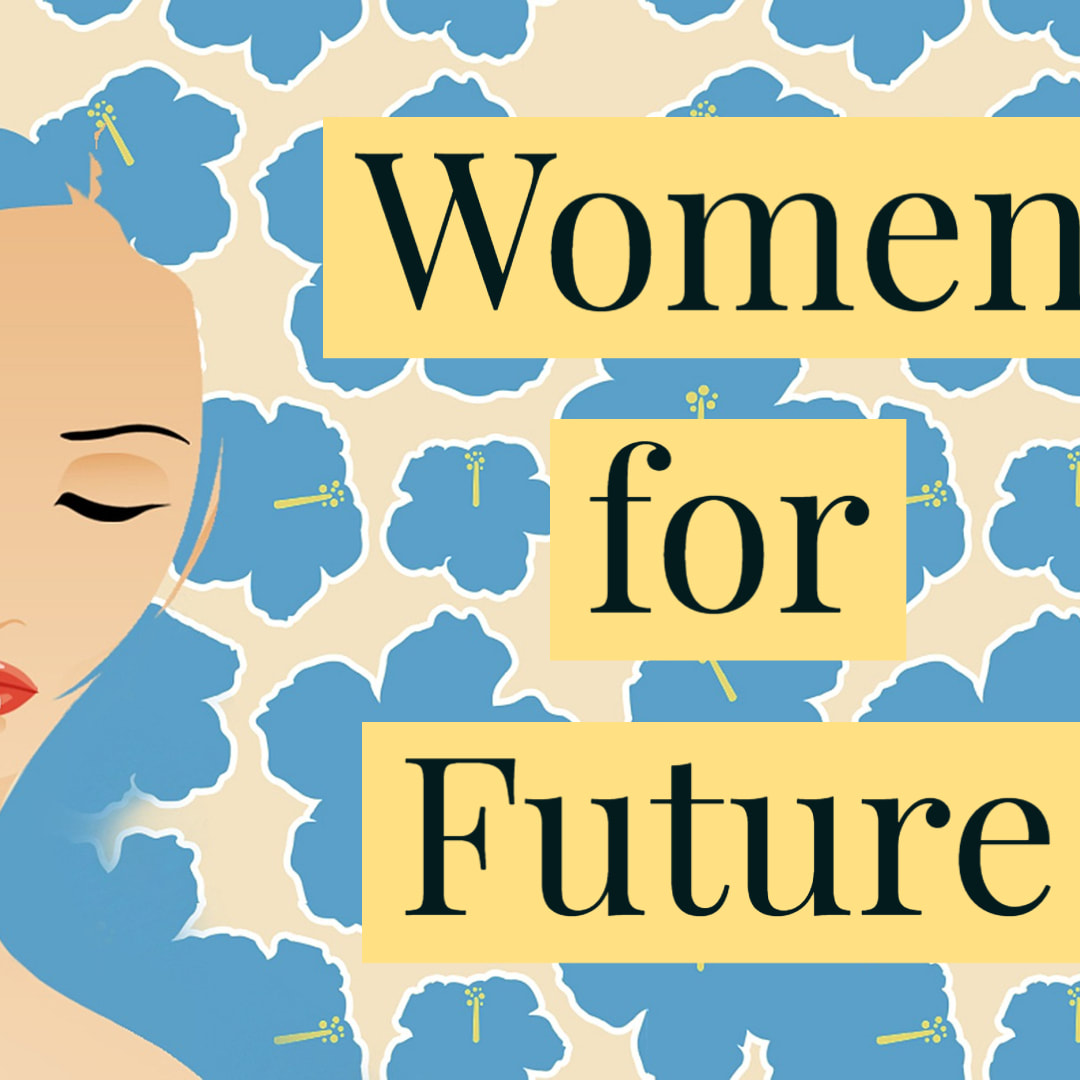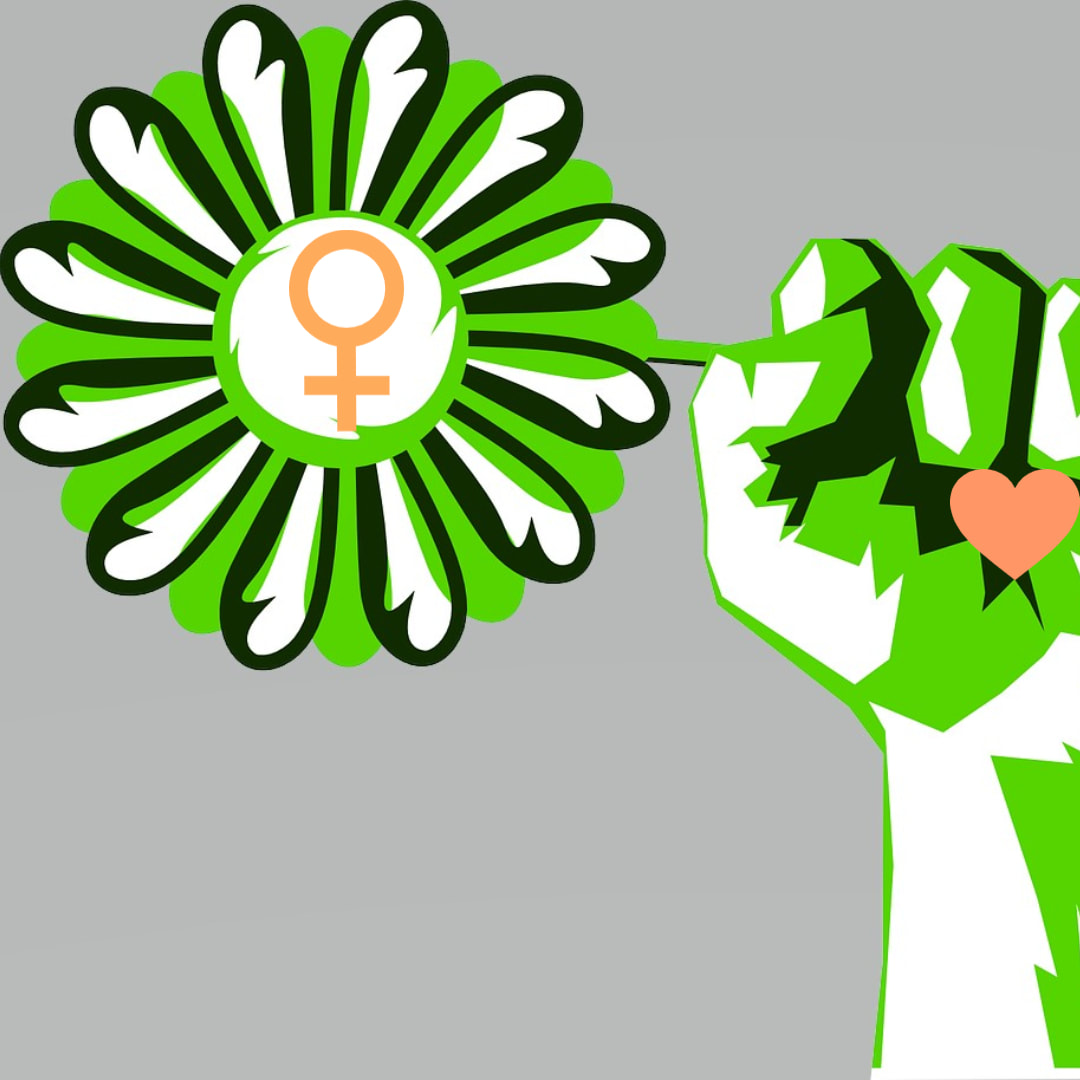(Auf)Wind und kleine WunderDie Allgäuer Alpen sind die Heimat von Gleitschirmpilotin und Psychologin Yvonne Dathe. Was das Fliegen ihr über sich und das Leben gelehrt hat und wie sich dieses Wissen auch in der Corona-Krise anwenden lässtVon Verena Elisabeth Schümann Früh hegt Yvonne Dathe den Traum vom Fliegen. Bereits als Kind stellte sie sich vor, wie sie von einem Stein springt, abhebt und wenig später wie ein Vogel in der Luft kreist. Damals ahnt sie noch nicht, dass sich der Wunsch nur wenige Jahre später mit dem Gleitschirm erfüllen wird. Yvonnes Eltern trennten sich, als sie gerade ein Teenie ist. Weil sie ihren Vater von nun an weniger oft sieht, sucht sie nach einer gemeinsamen Beschäftigung. Es gilt, die knappe Zeit bestmöglich zu nützen. Und wie gelingt das besser, als beim Fliegen in den Allgäuer Alpen? Das Gleitschirmfliegen wird zu einem gemeinsamen Hobby für Vater und Tochter, das vor allem Yvonne nie wieder loslassen wird. „In der Luft mit dem Schirm aufzudrehen und eine Einheit mit der Natur zu bilden, ist das Schönste für mich“, sagt sie einmal darüber. Mit der Leidenschaft kommt der Erfolg und nach einigen Jahren zählt Dathe zu den besten Gleitschirmpilotinnen Deutschlands. Sie wird Teil des deutschen Nationalteams, bestreitet erfolgreich Wettkämpfe. Dabei hatte sie das Gleitschirmfliegen lange Zeit nur als „Abstiegshilfe“ bei Bergwanderungen betrachtet. Erst durch ihren Lebenspartner Thomas Ide, selbst Gleitschirmpilot, hatte sich ihre Sichtweise geändert. Sie begreift, dass sie neben kurzen auch lange Strecken – bis zu 200 Kilometer weit, am Stück – fliegen kann. „Das hat mir eine ganz neue Welt eröffnet. Wenn man die Gletscher der Tiroler Alpen von oben sieht, wird einem bewusst, wie klein wir Menschen und unsere Probleme sind.“ 2014 nimmt sie an der X-Pyr teil, einem Rennen mit 439 Kilometern Länge, von der spanischen Atlantikküste über die Pyrenäen bis ans Mittelmeer. Weil beim Gleitschirmfliegen das Wetter den Ton angibt, analysiert sie vor jedem Wettkampftag die Luft- und Landkarten des Fluggebiets sehr genau: Woher kommt der Wind? Wie stark ist er? Wo kann Thermik – warme Luft, die nach oben steigt – aufkommen? „Das ist aber auch das Faszinierende am Gleitschirmfliegen: Jeder Tag ist irgendwie anders“, sagt Dathe. Ihr gelingt, was nur wenige schaffen: Sie kommt nicht nur erfolgreich durch die X-Pyr, sondern schafft es im selben Jahr auf den dritten Platz bei den Europameisterschaften. Nur zwei Jahre später ergattert sie die Bronzemedaille im Paragliding World-Cup in Gemona (Italien). Insgesamt wird Dathe fünfmal Deutsche Meisterin im Gleitschirmfliegen. „Mein Sport beschert mir viele wundervolle Momente. Er bringt mich auch in Gegenden auf der Welt, in die ich wahrscheinlich nicht so einfach hingekommen wäre.“ Wie nach Kolumbien, wo sie in der Luft sogar auf Geier trifft. „Mit Vögeln zu fliegen ist sehr besonders. Wenn ich lautlos dahingleite und andere Tiere nicht in ihrem Lebensraum störe, im Gegenteil, sie mich als Teil der Natur akzeptieren und neugierig auf mich sind, mich einen Teil des Weges begleiten, dann ist das magisch.“ Und weil sie ihre Leidenschaften mit anderen teilen möchte, nimmt sie seit 2009 auch andere Menschen als Passagiere auf ihren Höhenflügen im Tandem mit. "Beim Gleitschirmflug hat der Alltag keinen Platz und die Sorgen werden ganz klein", sagt Yvonne Dathe. Quelle: Privat Neben den positiven Erlebnissen gibt es für die 44-Jährige auch heikle Momente. Es passierte auf einem Wettkampf vor rund zehn Jahren. An dem Tag gab es keine starke Thermik, keinen starken Aufwind. Alle Wettkampfteilnehmer befanden sich in der Luft auf ungefähr gleicher Höhe, als ein anderer Pilot plötzlich in den Gleitschirm der Allgäuerin flog und sich darin verfing. Sie stürzten ab, blieben über dem Boden in ein paar Bäumen hängen und waren – wie auf wundersame Weise – unverletzt geblieben. Spurlos war der Unfall dennoch nicht an Yvonne Dathe vorübergegangen. Etwas hatte sich verändert. Jetzt hatte sie Angst, wenn sie gemeinsam mit anderen Piloten in der Luft war. Dann raste ihr Herz, ihre Knie zitterten und ihre Hände wurden schweißnass. Ihr Unterbewusstsein weiß, der Vorfall kann sich wiederholen. Immer wieder muss sie ihre Flüge frühzeitig abbrechen. „Das war hart. Aber das Gleitschirmfliegen ganz aufgeben, kam nie infrage.“ Stattdessen will sie in ihre „alte“ Form zurückfinden. Die Ausbildung zur Mentaltrainerin macht ihr den Weg frei, bietet ihr Hilfe zur Selbsthilfe. Beim Landeanflug in der Türkei. Quelle: Privat Im ersten Schritt schafft sie sich neue Glaubenssätze, die sie sich beim Fliegen vorsagt: „Ich achte auf andere und vertraue darauf, dass sie das auch tun. Das zu wiederholen und dabei meinen Atem bewusst fließen zu lassen, half mir während des Fluges nicht zu verkrampfen. Sicherlich war Angst da, das akzeptierte ich. Die Kunst war vielmehr, sich nicht von ihr beherrschen zu lassen.“ Durch Entspannungstechniken stabilisiert sie sich, dass sie erneut an Wettkämpfen teilnehmen kann. „Richtig locker war ich da noch nicht. Das kam erst zwei Jahre später. Da hat es im Kopf einfach Klick gemacht. Und das Fliegen fühlte sich wie früher an. Das war ein Befreiungsschlag für mich.“ Heute weiß Yvonne Dathe, das Verarbeiten des Unfalls hatte ihr etwas Wunderbares über sich und für ihre Arbeit als Psychologin beigebracht. „Gleitschirmfliegen ist eine Lebensschule. Hat jemand ein Problem beim Fliegen, hat er es auch in anderen Bereichen des Lebens. Löse ich es beim Fliegen, löse ich es überall.“ Zum Beispiel lehrt das Fliegen dem Ungeduldigen Geduld und Demut. Denn nur eine stabile Wetterlage macht einen Gleitschirmflug erst möglich. Und diese muss ein Pilot abwarten können. Ebenso kann es dem Wankelmütigen beibringen, schnell Entscheidungen zu treffen. Dreht der Wind und Thermik kommt auf, muss der Pilot in der Luft schnell reagieren können, um höher zu steigen. Nur wer rasch auf die Umstände eingeht, hat die Chance weiterzukommen. Klappt es einmal nicht, muss die Situation akzeptiert und gelöst werden. Das fördert sogar die Resilienz und hilft dabei, Krisen wie die derzeitige zu überstehen. Die Corona-Krise ist eine völlig neue Situation, die vielen Menschen Angst macht. Aber auch hier lehrt das Fliegen, was sich im Krisen-Alltag anwenden lässt: Ruhig bleiben, nicht panisch werden, und die Situation realistisch betrachten. Denn eines ist gewiss, wie beim Fliegen, auch im Leben: Irgendwann geht es wieder aufwärts, der nächste Aufwind kommt bestimmt. Seit 2009 nimmt Yvonne andere Menschen als Passage mit dem Gleitschirm mit. Nach Corona soll das wieder eingeschränkt möglich sein. Quelle: Privat Für Yvonne Dathe kann das Gleitschirmfliegen noch weit mehr. „Erst letztens ging mir wieder einmal mein Herz über vor Glück“, erzählt sie. Es war recht spät, als sie mit ihrem Schirm vom Breitenberg im Allgäu losflog. Der Aufwind war weich und sie schwebte förmlich in der Luft. Die Sonne stand tief und verbreitete sanftes Licht am Himmel. „Alles um mich herum fühlte sich so friedlich und ruhig an. Als ich landete, war mein Alltagsstress wie weggeblasen und ich musste vor Freude und Rührung lächeln. Da war mir einmal mehr bewusst, wie sehr ich das Fliegen liebe und dass ich es noch mit 80 tun möchte.“
0 Comments
Die Macht der BücherGerade erleben wir die zweite Corona-Welle. Viele von uns sind wieder im (Teil)Lockdown und dürfen niemanden treffen. Das soziale Leben ist völlig eingeschränkt und zum Erliegen gekommen. Kinos und Kulturbetriebe, Theater sind geschlossen. Live-Konzerte gibt es schon lange nicht mehr! Nicht wenige Menschen fühlen sich gerade jetzt wieder sehr einsam und leiden unter den Einschränkungen. Und nicht jeder hat eine/n Partner/Partnerin, der das auffängt. Was aber kann man tun, wenn gerade jetzt die Seele unter Corona und den sozialen Einschränkungen leidet?Tatsächlich gibt es ein Mittel, das gegen den akuten Corona-Blues helfen kann: Bücher. Gerade jetzt sind sie Balsam für die krisengeplagten Seelen. Bücher gibt es viele, sie sind dicke Wälzer oder schmale Hefterln. Sie kommen als Romane, Ratgeber, Liebesgeschichten, historische Krimis und Biographien vor. Sie fungieren als Wissensvermittler, Erzähler oder bloße Unterhalter. Und alle wollen die Leser in andere Realitäten entführen, zum Träumen oder Nachdenken anregen, den Kummer vertreiben, zum Lachen bringen oder, im besten Fall, ein Abenteuer für den Kopf sein - wenn Corona einen schon in die Isolation zwingt. Bereits lange vor der Pandemie haben drei Frauen die große Macht von Büchern und Wörtern kennengelernt, die ihr Leben für immer verändert haben. Von Verena Elisabeth Schümann Eine Handvoll Worte für einen Neuanfang Marlies Schnabel liebt das Fotografieren. Für ihre Bilder streift sie schon einmal durch den Wald, um seine Stimmung einzufangen, oder steigt auf den höchsten Aussichtspunkt, um ihren Heimatort, Göstling an der Ybbs in Niederösterreich, im Herbstlicht abzulichten. Aber am liebsten fotografiert sie Familienfeiern. In ihrer Freizeit macht sie das regelmäßig. Marlies hat ein gutes Auge, ein Gespür für Licht und Schatten, für Farben und Formen, für ihre Mitmenschen. Schaut sie durch ihre Kameralinse, schärft sich der Blick ihrer Umgebung und drückt sie dann auf den Auslöser, fängt sie binnen Sekunden das Leben ein und hält es fest. Marlies kontrolliert die Fotos. Quelle: Privat Ihr eigenes verlor die heute 24-Jährige allerdings vor einiger Zeit aus den Augen. Lange verlief alles in geordneten Bahnen. Marlies hat ihre Lehre zur Einzelhandelskauffrau erfolgreich abgeschlossen, einen Freund, den sie liebt und mit dem sie zusammen in die Steiermark zieht, eine gute Arbeit. Sie fährt auf Urlaub, trifft Freunde und geht aus. Bis sich vor zweieinhalb Jahren der Wind dreht. Immer öfter ist Marlies schlecht gelaunt, streitet sich mit ihrem Freund – obwohl sie das eigentlich gar nicht will – und verliert sich in zermürbenden Grübeleien und Gedankenspiralen. Die ansonsten so fröhliche junge Frau ist völlig verunsichert, beginnt an sich zu zweifeln und im Umgang mit anderen infrage zu stellen. „Hab ich den richtigen Ton getroffen? Hätte ich das fragen sollen? Warum habe ich nichts gemacht? Was ist bloß los?“ Ein guter Freund sagt ihr das ins Gesicht, was sie sich selbst nicht eingestehen kann. „Merkst du eigentlich nicht, dass du nur noch deinem Freund hinterher läufst, sein Anhängsel bist und selbst gar nichts mehr sagst, zu keinem Gespräch mehr etwas beiträgst?“ Eine Aussage, die wehtut. Aber Marlies weiß, er hat recht. Lange war ihr nicht klar, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse hintangestellt, dass sie sich ausschließlich auf ihren Freund konzentriert hatte. Weil er in der Steiermark eine Arbeit gefunden hatte, hatte auch Marlies ihre Heimat verlassen und war mit ihm mitgegangen. Als er einige Zeit später den elterlichen Hof in Niederösterreich erbte und wieder zurück ging, war klar, dass auch Marlies mitkommen würde. „Ich komme selbst von einem Bauernhof, ich fand das gut und schön. Anfänglich sogar, dass sein, unser Leben damit vorgezeichnet war.“ Auch die gemeinsamen Urlaube plant und organisiert er, mit seinen Freunden gehen sie meistens am Wochenende aus. Es ist sein Leben, das Marlies führt. Durch die offenen Worte ihres Freundes erkennt sie aber mit einem Mal, dass sie ihre Träume und Ziele völlig vernachlässigt hat und gar nicht mehr weiß, wer sie eigentlich ist. Um sich von trüben Gedanken und schlechten Aussichten abzulenken, kauft sie sich den Roman „Eine Handvoll Worte“ von Jojo Moyes. Die Autorin kennt sie bereits, ihre Bücher versprechen eine ersehnte Abwechslung. Dass Marlies intuitiv zu einer Geschichte greift, die die Weichen ihrer Zukunft stellt, ahnt sie nicht. In dem Roman geht es um die verheiratete Jennifer Stirling, die sich in einen anderen Mann verliebt. Als er sie bittet, alles für ihn aufzugeben, endet die vermeintliche Liebesbeziehung. Jennifer schafft es nicht, ihren Ehemann zu verlassen, obwohl sie einen anderen liebt. Erst Jahre später findet die junge Journalistin, Ellie Haworth, Briefe, in denen ein unbekannter Absender eine Frau bittet, ihren Ehemann zu verlassen. Ellie findet auch heraus, dass die unglücklich Verliebten rund 30 Jahre in ein und derselben Stadt gelebt hatten, ohne zueinanderzufinden. Jennifer hatte es nicht geschafft ihren Ehemann zu verlassen. Dazu fehlte ihr der Mut. Stattdessen hatte sie die Chance auf eine glückliche Zukunft mit einer neuen Liebe verstreichen lassen. Eine Chance, die nie wieder kommen würde. Beim Lesen realisiert Marlies, dass sie nicht wie Jennifer enden will. Dass sie es selbst in der Hand hat, glücklich zu werden. Dass nur sie für sich und ihre Bedürfnisse einstehen kann. Sie sagt: „Ich will die Augen nicht mehr vor den Sachen verschließen und den Mut haben, mich dem zu stellen, wovor ich Angst habe. Ich möchte selbst entscheiden, wie mein Leben aussehen soll. Dafür muss ich Sachen ändern, die sich für mich falsch anfühlen." Und tatsächlich, ein paar Wochen später, im März 2019, trennt sich Marlies endgültig von ihrem Freund. „Das war ein großer Schritt und nicht leicht, mein Leben war ja komplett nach seinem ausgerichtet.“ Spontan geht sie in ein Reisebüro und bucht eine Woche Zypern, im Herbst fährt sie mit dem Zug alleine für ein Wochenende nach Rom. Innerhalb eines Jahres besucht sie mit ihren Freundinnen rund 20 Konzerte. „War ich speziell vor meiner ersten Reise noch sehr unsicher, ob ich das alleine überhaupt alles schaffe, weiß ich heute, was ich alles kann. Ich bin viel selbstbewusster geworden und weiß, wer ich bin und was ich will. Ich möchte weiterhin alleine aber auch zusammen verreisen und Abenteuer erleben, neue Menschen kennenlernen, will weiterhin mutig sein und nicht zu viel über alles nachdenken. Schließlich habe ich nur ein Leben.“ Mittlerweile ist Marlies in einer neuen Beziehung, in der sie sich selbst treu bleiben kann. Wenn der Mut einen Schubser braucht „Ich bin ein quirliger Typ, stecke immer voller Ideen und Tatendrang“, sagt Gabriella Nagy über sich selbst. Ihre braunen Augen leuchten, wenn sie spricht. Sie erzählt schnell und lacht viel. Aufgewachsen ist die 41-Jährige am Attersee im Salzkammergut, in einer idyllischen Umgebung, die aussieht wie aus dem Bilderbuch oder perfekt inszeniert für Instagram. Weil Gabriella neugierig auf die Welt um sie herum ist, siedelt sie mit 19 Jahren nach Graz um, jobbt zunächst in der Gastronomie, später im Callcenter. Das macht ihr Spaß, sie ist gesellig und mag es, von anderen Menschen umgeben zu sein. Aber immer dann zu arbeiten, wenn andere frei haben oder feiern, zerrt irgendwann an den Nerven und sie fasst den Entschluss, noch einmal die Schulbank zu drücken und eine Ausbildung als Bürokauffrau zu machen. Da ist sie bereits 30. „Alter ist für mich nur eine Zahl. Ich probiere gerne Neues aus und bin keine ängstliche Person“, sagt sie. Sie meistert die Ausbildung gut und arbeitet seit 2012 in einer Kanzlei für Steuerberatung. Die Arbeit liegt ihr, sie macht sie gerne. In ihrer freien Zeit entdeckt sie die sozialen Medien, vor allem Instagram für sich. Dort lernt sie auch die Mentaltrainerin, Buchautorin und Bloggerin Melanie Pignitter kennen. Vor fünf Jahren machte die Steirerin selbst eine schwere, persönliche Krise durch. Von einem Tag auf den anderen leidet sie an täglich auftretenden Kopfschmerzen, die so stark sind, dass ein normaler Alltag nicht mehr möglich scheint. Depressionen. Ängste. Schmerzen und Arztbesuche dominierten für rund ein Jahr ihr Leben. Nur mit Geduld, Selbstfürsorge und dem Wissen aus ihrer Tätigkeit schaffte sie den Weg zurück in ein normales Leben. Heute weiß sie genau, es gibt schlechte und gute Tage, aber ein Klecks Honig bleibt immer auch ein süßer Patzer. Darüber schreibt sie in ihrem Buch und in den sozialen Netzwerken. In ihren Posts verbreitet sie Optimismus, Mut und ruft ihre Follower zu Selbstakzeptanz- und liebe auf, veröffentlicht tiefsinnige Sprüche und schöne Fotos – gerade die gefallen Gabriella auch sehr. Und mit einem Mal hat die Oberösterreicherin eine Idee: „Ich gründe ein Start-up. Eine „Selfie-Farm“, ein mobiles Fotostudio.“ Dafür soll ein umgebauter Baucontainer mit professionellem Equipment wie Licht, Spiegel, et cetera ausgestattet werden, damit aufstrebende Influencer dort ihre Videos drehen und Fotos für die sozialen Medien schießen können. Ein Jahr lang recherchiert sie, wie sie ihre Idee realisieren und sich selbstständig machen kann, bis Corona dem Plan einen Riegel vorschiebt. Eine enttäuschende Situation. Wie soll sie diese Zeit nun sinnvoll und kreativ nutzen, was anstelle tun? „Ich weiß“, sagt sie, „ich starte einfach einen Blog, mache meine eigenen schönen Fotos.“ Ihre Euphorie wird allerdings von ihrer inneren Stimme gebremst, die Zweifel einräumt. Bist du für so etwas nicht zu alt? Du hast doch kein technisches Know-how! Was, wenn du scheiterst und dich blamierst? Hast du überhaupt Themen, worüber du schreiben kannst? Du bist doch kein Trendsetter! „Eigentlich war es gar nicht meine Art, derart an mir zu zweifeln und mich von meinem eigenen Vorhaben verunsichern zu lassen. Zumal ich den eigenen Blog ja unbedingt wollte. Nur hatte ich null Ahnung davon und das machte mir große Sorgen. Ich hatte keine Lust, damit baden zu gehen“, erzählt Gabriella. Auch wenn es manchmal Arbeit bedeutet, Gabriella hat den Start ihres Blog nie bereut. Quelle: Privat Es ist das Kapitel „Warum Scheitern erfolgreich macht“ aus Melanie Pignitters Buch „Honigperlen“, das ihr den Anstoß in die richtige Richtung gibt. So heißt es in ihrem Buch sinngemäß: Traue dich, versuche dein Glück, setze deine Pläne um. Allein der Versuch wird dein Leben bereichern, dich in deiner Entwicklung voranbringen. Denke auf deinem Weg daran, dir selbst immer treu zu bleiben. Und wenn etwas nicht klappt, weißt du, nichts und niemand ist perfekt. „Das hat mir so aus der Seele gesprochen. Warum sollte ich es nicht wagen? Entweder es klappt oder nicht.“ Tatsächlich traut sich Gabriella und geht nur einige Zeit später, am 18.11.2019 mit „Galunas Blog“ online. Sie sagt: „Ich bin stolz, dass ich mich meinen Ängsten gestellt und es gewagt habe.“ Nun schreibt sie regelmäßig über sich und ihr Leben. „Ich poste auch Fotos von mir, zeige mein Zuhause im Grünen mit dem wundervollen Ausblick und verwende dabei sogar lustige Filter. Aber nicht zu viele, sonst bin das nicht mehr ich.“ Das Buch Honigperlen war für Gabriella Ratgeber und Wegweiser. Quelle: Privat Oh, wie schön ist Panama Langsam wandert die Sonne über den Horizont und bringt die Karibische See zum Funkeln. Die Wellen rauschen stetig und rollen sanft an Land. Der weiße Sand auf der kleinen Bucht erstrahlt ganz hell. Ein neuer Tag beginnt, auch im angrenzenden Regenwald. „Jeden Morgen wecken mich die Brüllaffen und Papageien“, erzählt Johanna Blumenschein. Die 66-Jährige lebt auf einer Finca auf der Insel San Cristobal in Panama, unweit von dem Dschungel und dem Strand entfernt. Seit 2007 ist es ihr Zuhause und ihr Lebensmittelpunkt. „Ich liebe es hier, hier fühle ich mich frei und angekommen. Hier habe ich Nietzsches Zarathustra endlich ganz verstanden. Denn hier kann ich sein, wie ich bin und leben, wie ich es für richtig halte – ohne, dass mir jemand etwas vorschreibt, und im Einklang mit der Natur“, sagt sie. Johanna wird 1953 in Wien geboren und wächst in einer Zeit voller konservativer Lebensentwürfe und Rollenbilder auf. Zunächst besucht sie die Volksschule, später das Gymnasium, wo sie im Unterricht zum ersten Mal von dem Philosophen Friedrich Nietzsche hört und mit 17 Jahren sein Buch „Also sprach Zarathustra“ liest. Ein revolutionäres und reaktionäres, kontroverses Werk. „Es ist an der Zeit, dass der Mensch sich sein Ziel stecke. Es ist an der Zeit, dass der Mensch den Keim seiner höchsten Hoffnung pflanze […]. Ich sage euch, man muss noch Chaos in sich haben, um einen tanzenden Stern zu gebären.“ Es sind Nietzsches Worte, die Johanna faszinieren und nicht mehr loslassen werden. „Das hat mir damals geholfen, meine eigenen, wirren Gedanken zu ordnen und ich erkannte, etwas in mir war gefangen. Nur was, das wusste ich damals noch nicht“, sagt sie. Wahrscheinlich ist es der Wunsch sich selbst und die Menschen zu verstehen, weswegen sie nach der Matura Psychologie, Linguistik und Philosophie studiert. Noch während des Studiums heiratet sie und bekommt zwei Kinder, arbeitet dann im Marketing großer Pharmafirmen, macht ihre Dissertation. Nach außen hin scheint alles in geordneten Bahnen zu verlaufen. Innerlich sieht es bei Johanna anders aus. Immer wieder sehnt sie sich nach der Freiheit, ihre eigenen Entscheidungen treffen und danach handeln zu können. Stets in einer Herde mitzulaufen, widerstrebt ihr. Wieder muss sie an Nietzsche denken, der in seinen Werken das eigenständige Handeln und Denken der Menschen nahezu propagiert hatte. Johanna fühlt sich erdrückt in ihrer Rolle und von den Normen, die ihr die Gesellschaft auferlegt hatte. Sie spürt, sie muss einen anderen Weg gehen – auch für ihre Kinder. Denn nur eine glückliche Mutter ist eine gute, weiß sie. Schließlich lässt sie sich von ihrem Mann scheiden. Die Kinder bleiben bei ihr. Nach zehn Jahren kündigt sie auch ihren Job als Angestellte in der Pharmabranche und macht sich selbstständig. Jetzt kann sie frei arbeiten, sich ihre Zeit einteilen, wie es ihr gefällt, und Projekte im Ausland akquirieren. Dafür reist sie in die Länder des ehemaligen Ostblocks. In den Schulferien nimmt sie ihre Kinder dahin mit. Zu ihnen hat Johanna auch heute noch ein gutes Verhältnis. Bei all den Reisen bleibt ihr Stützpunkt immer Wien und der Wiener Wald. Dorthin zieht es sie, wenn sie ein wenig Ruhe und Erholung sucht. Dann reitet sie mit ihrer Stute aus. Denn Johanna weiß, wenn ihr der Wind um die Nase weht, spürt sie das Glück der Erde. Das ändert sich mit einem schweren Reitunfall 1999. Zusammen mit ihrem Pferd war die Wienerin gestürzt und gegen einen Baum geprallt, ihre Wirbelsäule dreimal gebrochen. Ein Schock. Dennoch hatte sie Glück im Unglück: Eine Operation versprach gute Chancen auf Heilung, sie würde nicht im Rollstuhl sitzen müssen, würde wieder gehen und reiten können. Aber würde sie auch sonst „die Alte“ sein? „Ich war sechs Wochen im Krankenhaus und hatte viel Zeit zum Nachdenken“, erzählt sie. „Ich stellte mir die Frage, was will ich in meinem Leben noch machen? Wo will ich hin? Was treibt mich an und wo finde ich meine Erfüllung?“ Immer wieder kommen ihr die Worte aus „Also sprach Zarathustra“ in den Sinn. Und sie weiß: „Ich will frei sein. Ein freier Mensch und neugierig bleiben, die Welt voller Wunder erhalten.“ Nach ihrer Genesung macht sie sich deshalb auf die Suche nach dem Ort, wo sie von nun an für immer leben will, und findet ihr Paradies. Sie verliebt sich in ein 50 ha großes Stück unberührter Natur und entscheidet spontan, es zu kaufen. Wenig später wandert Johanna aus, verlässt ihre Heimat Wien und fängt in Panama ganz neu an. Sie legt die Sumpflandschaft vor Ort trocken, baut eine Finca, stattet das Dach mit Solarpaneelen aus und sammelt Regenwasser, legt natürliche Obstplantagen und Gemüsegärten an. Heute ist daraus eine ökologische Farm entstanden, wo Johanna mit zwei Hunden, drei Katzen, Pferden, Hühner und einem Papagei nahezu autark lebt. „Das ist harte Arbeit. Aber ich liebe diese Arbeit mit den Händen in der Erde. Das ist das, was mich ausmacht und das, was Nietzsche in seinem Buch gemeint hat: Überwinde die Normen, wage es, zu träumen und eigene Visionen zu haben. Traue dich, diese auch zu verwirklichen. Das habe ich gemacht. Und ich muss sagen, das Leben ist schön, schön hier in Panama.“ „Nach Panama auszuwandern, war die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt Johanna. Quelle: Privat WOMEN FOR FUTURESchon vor 50 Jahren gab es Umweltschützerinnen. Wofür wir ihnen danken sollten und warum es in der Klimakrise immer wichtiger wird, dass Frauen sich einsetzen.Die Bilder aus dem Fernsehen sind in unseren Köpfen noch recht präsent. Es ist Freitag. Greta Thunberg, die Haare trägt sie zu langen Zöpfen geflochten, sitzt vor dem schwedischen Parlament in Stockholm. Sie hält ein Schild hoch. „SKOLSTREJK FÖR KLIMATET“ („Schulstreik für das Klima“). Über ein Jahr später ist aus dem Mädchen die weltweit bekannteste Klimaaktivistin geworden. Eine Fünfzehnjährige, die andere Jugendliche animiert, gegen Zerstörung und Ausbeutung unseres Planeten zu kämpfen. „Fridays for Future“ ist geboren. Für ihre Ansichten segelt Greta auch zur UN-Klimakonferenz nach New York, um am 23. September 2019 in einer Rede schonungslos mit den Politikern abzurechnen. „Menschen leiden, Menschen sterben, ganze Ökosysteme kollabieren. Wir sind am Anfang eines Massen-Aussterbens, und alles, worüber Sie reden können, sind Geld und Märchen vom ewigen wirtschaftlichen Wachstum. How dare you?!“ („Wie könnt ihr es wagen?!“). Dass ein Mädchen so lautstark und wütend reagiert, verwundert nicht. Soziologie-Professor Dr. Peter Preisendörfer hat 2007 in einer Rede gesagt: „Frauen äußern sich in stärkerem Maße als Männer besorgt, beunruhigt und auch empört und wütend über die ungelösten Umweltprobleme. Insbesondere gegenüber lokalen Umweltgefährdungen artikulieren Frauen eine größere Betroffenheit.“ Sind Frauen aber auch die besseren Umweltschützer? „Ein Mehr an Einsicht gibt es bei den Frauen insoweit, als Umweltbelastungen häufiger als ein wichtiges Problem anerkannt und eingeschätzt werden. Männer neigen eher dazu, Umweltprobleme zu verharmlosen oder zu bestreiten." Auf der Ebene der Handlungsbereitschaft sind Frauen stärker umweltbewusst sowohl mit Bezug auf ihr persönliches Umweltverhalten, als auch mit Bezug auf Handlungsaufforderungen gegenüber anderen. Frauen sind eher bereit, zugunsten des Umweltschutzes ihr eigenes Verhalten zu ändern, und sie fordern auch häufiger z. B. ein stärkeres Engagement des Staates und von Wirtschaftsunternehmen.“ Sein Fazit: „In der Gesamtschau gilt, dass sich Frauen im Durchschnitt umweltorientierter verhalten als Männer.“ [ 1] „Frauen kümmern sich vermehrt um Haushalt, die Kindererziehung und die unbezahlte Care-Arbeit. Diese Struktur ist ein Grund, warum Frauen mehr Engagement im privaten und weniger im öffentlichen Bereich zeigen“, sagt Diplom-Psychologin Josephine Tröger. Regionale Lebensmittel, ohne Plastikverpackung, biologisch abbaubare Reinigungsmittel und nachhaltige Kleidung sind vermeintlich eher Frauensache. Außerdem ist Umweltschutz noch immer kein Statussymbol. „In der Regel gilt: Wer grün handelt, wird häufig eher mit einem niedrigeren sozialen Status assoziiert. Gerade vielen Männern ist ihre eigene, gesellschaftliche Position meist wichtiger als Frauen und sie fürchten den Verlust durch bestimmtes Umweltengagement. In der Psychologie spricht man von der „bedrohten Männlichkeit“, wenn Männer plötzlich Umweltengagement in den Bereichen zeigen sollen, die vermeintlich eher den Frauen zugeschrieben werden, so Tröger. Ein möglicher Grund, warum sich mächtige Männer ungern schützend vor die Natur stellen. Bei einer Frau wäre das wahrscheinlich anders. Hat sie eine Führungsposition inne, handelt sie durchschnittlich umweltfreundlicher als gleichgestellte, männliche Kollegen. Gräbt man etwas in der Geschichte, sind es Wissenschaftlerinnen, wie Dian Fossey, Jane Goodall und Birutė Mary F. Galdikas, die bereits in den 1960ern und 70ern über unsere nächsten Verwandten, die Menschenaffen, forschten. Oder Rachel Carson. Schon vor über 50 Jahren war sie eine Öko-Vorreiterin – lange vor der Klimakrise und Greta Thunberg. Die 1907 geborene Biologin, Zoologin und Autorin veröffentlichte 1962 das Buch „Silent Spring“ („Der stumme Frühling“) und zeichnete bereits in den ersten Zeilen ein düsteres Zukunftsmärchen. „Es war einmal eine Stadt im Herzen Amerikas (...), inmitten blühender Farmen mit Kornfeldern, deren Gevierte an ein Schachbrett erinnerten, und mit Obstgärten an den Hängen der Hügel, wo im Frühling wolkenweißer Blüten über die grünen Felder trieben. (...) Den Großteil des Jahres entzückten entlang den Straßen Schneeballsträucher, Lorbeerrosen und Erlen, hohe Farne und Wildblumen das Auge des Reisenden. Dann tauchte überall in der Gegend eine seltsame schleichende Seuche auf. (…) Irgendein böser Zauberbann war über die Siedlung verhängt worden: Rätselhafte Krankheiten rafften die Kükenscharen dahin; Rinder und Schafe wurden siech und verendeten. Über allem lag der Schatten des Todes. (...)“ Am Ende der Geschichte sind die Felder grau, die Bäume kahl, die Vögel zwitschern nicht mehr, denn sie sind verschwunden. Diese dystopische Welt will Carson in Wahrheit aber verhindern.[2] Ihr Buch sollte ein Weckruf sein, über DDT und anderen chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln aufklären, auf die Gefahr für Umwelt, Menschen und Tiere hinweisen. Das gelingt ihr, nur wenige Jahre später wird DDT verboten. Auch die Kenianerin Wangari Muta Maathai schrieb als Biologin und Umwelt- und Menschenrechtsaktivistin vor über 40 Jahren Geschichte. Sie war nicht nur die erste Frau in Ost- und Zentralafrika, die einen Doktortitel an der Universität Nairobi erwarb, sie initiierte auch „The Green Belt Movement“ („Die Grüngürtel-Bewegung“). Obwohl Maathai als Professorin für Veterinäre Anatomie viel erreicht hatte, blieb sie ihrem geliebten Kenia mit seiner außergewöhnlichen Natur und seinen Wildtieren immer eng verbunden. Umso mehr muss es sie wohl schmerzlich getroffen haben, als sie von den Frauen aus ihrer Heimat erfuhr, dass die Regierung immer mehr Bäume abholzen ließ, um Tee- und Kaffeeplantagen anzulegen. Die Folge war, der Boden erodierte. Wo vorher ein Bach war, lag danach alles brach, war schlammig oder ausgetrocknet. Die Wüste drohte sich auszubreiten, die Menschen und Tiere zu verhungern. Maathai erkannte als eine der Ersten, dass das Elend mit der Abholzung der Bäume zusammenhing und gründete 1977 ein Wiederaufforstung-Projekt. Sie war der Ansicht, dass das die Lebensumstände verbessern würde, dass „Bäume auch ein Symbol der Hoffnung und des Friedens seien.“ In kleinen Gruppen begann sie den Boden wieder aufzuforsten. Weil sie den Helfern auch einen kleinen Lohn zahlte, wurde das Projekt schnell zum Erfolg – sozial wie ökologisch. Bislang wurden in der Region rund 51 Millionen Bäume gepflanzt. Dadurch hat sich Natur erholt und die Menschen konnten ihr Land wieder beackern, sich selbst versorgen. Für ihr Engagement wurde „Mama Miti“ (Suaheli für „Mama der Bäume“) 2004 der Friedensnobelpreis verliehen. [3] Alle zuvor beschrieben Frauen haben eines gemeinsam: Sie waren Umweltschützerinnen, starke Frauen, die viel für die Natur unseres Planeten erreicht haben, und Vorbilder für nachfolgende Generationen. Wie Antje Boetius. Die Meeresbiologin leitet seit 2017 das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Oder Asha de Vos, die als sri-lankische Pionierin in der Blauwal-Forschung im nördlichen Indischen Ozean gilt. In Kenia macht sich die Ökologin Paula Kuhumbu für den Schutz der afrikanischen Wildtiere stark und gründete die Initiative „Hands off our Elephants“, die Elefanten vor dem Abschlachten wegen Elfenbeins schützen soll. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch die Hamburgerinnen Wienke Reynolds und ihre Kollegin Joana Gil, die daran arbeiten, aus Stroh Kunststoff herzustellen – nachhaltig, abbaubar. Aber längst ist Umweltbewusstsein keine Bewegung, kein Trend mehr und nicht nur etwas für die Wissenschaft. Im täglichen Leben ist Umweltschutz unerlässlich. Zu offensichtlich sind die Probleme. Das erkannten auch die beiden Schwestern Isabel und Melati Wijsen, die 2013, mit gerade einmal zehn und zwölf Jahren, das Projekt „Bye, bye plastic bags“ gegründet haben, um ihre Heimat Bali und die umliegenden Meere von dem Müll zu befreien. 2018 beschloss die balinesische Regierung Einweggeschirr, Trinkhalme und Säcke zu verbieten – nicht zuletzt aufgrund des unermüdlichen Einsatzes von Isabel und Melati. Oder die Kenianerin Phyllis Omido. Als 2009 ihr Sohn zur Welt kam, hatte er eine Bleivergiftung. Wie war es dazu gekommen? Die Schwermetalle waren durch die Bleischmelze umliegender Fabriken in die Umwelt gelangt, hatten sich im Brustgewebe der stillenden Mutter angesammelt und wurden dem Säugling über die Muttermilch verabreicht. Allerdings hatte er Glück im Unglück. Gerade noch rechtzeitig bekam er die richtigen Medikamente und wurde wieder gesund. Andere Kinder haben da nicht so viel Glück, werden nie wieder richtig gesund oder sterben. Dagegen kämpft Omido und gegen die schmutzigen Schwermetall-Abfälle der Fabriken, klagt sogar gegen sie. Phyllis Omido ist ein Beispiel dafür, dass vor allem Frauen und Kinder unter schlechten Umweltbedingungen leiden. Rückblende und Ortswechsel: 26. Dezember 2004. Kurz vor zwei Uhr nachts (Mitteleuropäische Zeit). Indischer Ozean. Rund 250 Kilometer süd-südöstlich vor der Insel Sumatra ereignet sich ein Seebeben der Stärke 9.1. Es ist eines der stärksten jemals gemessenen. Die Folge: ein Tsunami. Bis zu 20 Meter hohe Flutwellen erreichen nur eine halbe Stunde später Sumatra und die Nikobaren und zerstören ganze Landstriche. Häuser werden einfach weggespült, Menschen verlieren ihr Leben. Insgesamt sind 14 Länder, darunter Indonesien, Thailand, Sri Lanka, Indien, aber auch Somalia, Kenia und Tansania, betroffen. Rund 230 000 Menschen kommen in den Fluten um. 2005 stellte Oxfam in einem Bericht über die Umweltkatastrophe und ihre Folgen fest, dass „das Geschlecht eine Rolle spielt, wie Menschen von Katastrophen betroffen sind.“ So starben in etwa drei- bis viermal so viele Frauen in den Fluten, als Männer. Die Gründe sind unterschiedlich und profan: Die Frauen verbrachten die Zeit zuhause bei den Kindern, während einige Männer auf dem Meer fischten und von der Monsterwelle nichts weiter mitbekamen, außer vielleicht ein stärkeres Schaukeln. Die meisten Mädchen und Frauen konnten nicht schwimmen. In ihren umschlungenen Tüchern blieben sie viel leichter irgendwo hängen und ertranken. Man muss kein Feminist sein, um zu verstehen, dass Umweltschutz Frauenschutz bedeutet, dass es für unsere Gesellschaft selbstverständlich sein sollte, sich für bessere Lebensbedingungen für Frauen und Mädchen einzusetzen. Durch die Arbeit von Umweltschützern verstehen Gesellschaft und Politik langsam, dass man Gutes für unseren Planeten tun kann, tun soll, tun muss, damit wir alle zuversichtlich nach vorne blicken können. Klimakrise als Chance für Frauen? „Wenn Frauen ihre Power einsetzten und an Entscheidungen mitwirkten, wäre das ein Türöffner. Wenn Umweltschützerinnen einflussreiche Berufe wählen, sich um Listenplätze bei Parteien bewerben, und in allen Bereichen Klimaschutz auf die Agenden bringen würden, wäre das eine sehr wirksame, fortschrittliche Entwicklung! Wenn Umweltschützerinnen einflussreiche Berufe wählen, sich um Listenplätze bei Parteien bewerben, und in allen Bereichen Klimaschutz auf die Agenden bringen würden, wäre das eine sehr wirksame, fortschrittliche Entwicklung! Denn neue Studien konnten zeigen, dass sich Frauen in politisch wichtigen Positionen stärker für Infrastrukturen einsetzen, die ihnen eher eine gleichberechtigte Teilhabe ermöglichen, etwa im Bereich von Kita-Ausbau – und ähnlich ist es mit umweltpolitischen Handlungsfeldern. Sitzen mehr Frauen in den Parlamenten, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass mehr Umweltpolitik gemacht wird“, sagt Tröger. Das wäre sozial, ökologisch und ökonomisch ein Mehrwert. Bis es so weit ist, Frauen ihre Kräfte mobilisieren und noch aktiver werden, gibt es Umweltschützerinnen, die uns vormachen, wie es gehen kann. Sie verdienen es, dass man sie hochleben lässt, weil ihr Aktionismus unserer Natur und damit uns Menschen gilt und sie uns immer wieder zeigen: Macht was! Wir sind die Zukunft, Umweltschutz geht uns alle an! [1]https://www.researchgate.net/publication/310137174_Gender_und_Natur_Sind_Frauen_die_besseren_Umweltschutzer [2]https://books.google.de/books?id=6RlzDgAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=rachel+carson+silent+spring&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjqsfnSgtvnAhURuaQKHc1iByUQ6AEILjAA#v=onepage&q=rachel%20carson%20silent%20spring&f=false [3] https://www.greenbeltmovement.org/ *Aufgrund des besseren Leseflusses verzichte ich an dieser Stelle auf *innen. In jedem Fall sind beide Geschlechter gemeint. Berühre mich!Seit drei Jahren kuscheln Imke Pahlke (55) und Peter Rombach (53) professionell mit Fremden und organisieren sogar spezielle Partys. Ein Blick hinter die Kulissen gibt tiefe Einblicke in ungeahnte Sehnsüchte.Die Bären liegen schon mal dicht aneinander. Ob das bei Menschen auch so geht? Foto: pixabay In wenigen Minuten treffen alle angemeldeten Gäste ein und verwandeln das Zuhause von Imke Pahlke und Peter Rombach in eine Party. Eine Kuschelparty. Unter Anleitung der beiden Gastgeber können sich fremde Menschen vier Stunden lang berühren, streicheln, umarmen. „Das ist der Sinn der Veranstaltung“, sagt Imke Pahlke. Die Idee dazu stammt ursprünglich aus dem Mekka der Trends, aus New York, und schwappte vor einigen Jahren nach Europa über. Heute gibt es in fast jeder größeren Stadt eine Kuschelparty. Und seit drei Jahren auch in Kiel. Eigentlich ist Imke Pahlke Buchhalterin. Sie hat ein Talent für Zahlen, Rechnen liegt ihr. Allerdings spürte sie vor ein paar Jahren eine undefinierte Sehnsucht nach mehr. Sie probierte einiges aus und kam zu Reiki und zur Methode des Handauflegens. „Das fand ich spannend. Ich lernte, dass ich mit meinen Händen Energie bündeln und an andere und mich selbst weitergeben konnte.“ Von nun an betrachtete sie ihre Hände als wertvolles Geschenk und Berührung als etwas, womit sie die Selbstheilungskräfte und das Immunsystem im Körper ankurbeln und stärken, leichte Schmerzen vertreiben und generell mehr Energie in den Körper bringen konnte. Mittlerweile sind alle Teilnehmer der heutigen Kuschelparty angekommen. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters, aus unterschiedlichen Schichten der Gesellschaft und mit unterschiedlichen Geschichten. Aber alle haben eines gemeinsam, sie sind nervös. Manche freudig, weil sie wissen, was kommt. Andere sind angespannt. Ihre Gesichter drücken Unsicherheit und Unwissenheit aus. Vor allem für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind, wirkt alles ein wenig unheimlich. Nicht wenige stellen sich die Frage: „Wo bin ich hier gelandet? Auf was lasse ich mich gerade ein? Soll ich gehen oder bleiben?“ Imke weiß um die Unsicherheiten ihrer Gäste und zeigt Verständnis. „Als ich an meiner ersten Kuschelparty teilgenommen habe, hatte ich auch ein seltsames Gefühl. Und ohne Peter hätte ich mich auch nie getraut“, so die sympathische Kielerin. Genau deswegen sei ein sanfter Start und langsamer Einstieg ins heutige Kuscheln auch so wichtig. Denn keiner soll durch die neue Situation überfordert werden oder sich unwohl fühlen. Imke und Peter bitten die Männer und Frauen in das Wohnzimmer zu einer allgemeinen Vorstellungsrunde und fangen bei sich selbst an. „Gekuschelt habe ich selbst immer schon gerne“, erzählt Imke. „Früher mit meiner Tochter, dann mit Peter.“ Weil ihr Lebenspartner selbst begeisterter Kuschler ist, besuchten sie vor mehr als drei Jahren eine Kuschelparty in Hamburg. Die hatte ihnen dann so gut gefallen, dass sie beschlossen, so etwas auch in Kiel anzubieten. „Schließlich sind wir Menschen soziale Wesen und brauchen Berührungen. Aber nicht jeder hat die Möglichkeit, sein Bedürfnis nach körperliche Nähe ausreichend zu stillen. Manche haben Partner, die keine Zeit oder Lust auf Streicheleinheiten haben. Andere sind verwitwet oder hatten noch nie einen Freund oder Freundin. Ich habe das Bedürfnis, Menschen diese Form der Körperlichkeit zu geben - als Gruppenerlebnis aber auch beim Einzelkuscheln“, erklärt Imke ihre Beweggründe. Gerade ältere Menschen leiden häufig unter fehlenden Berührungen und Einsamkeit. Foto: pixabay Die Gäste hören interessiert zu, stellen Fragen, reden mit. Langsam, ganz langsam tauen die Teilnehmer auf. Das spüren Imke und Peter und nutzen die Stimmung aus. Sie leiten ihre Gäste zu freiem Tanzen an. Die können sich nun im Raum bewegen, wie es ihnen gefällt und guttut. Einige wippen sanft hin und her wie Gräser im Wind. Andere nehmen die Arme mit. Wichtig ist: Jeder kann, niemand muss. Alles soll locker sein. Und damit das auch so bleibt, erklären die Gastgeber auch die No-Go's jeder Party. Denn eines ist klar, das hier hat nichts mit Sex zu tun. Alle Gäste behalten ihre Kleidung an, Küssen ist Tabu. Niemand berührt den anderen im Schambereich oder auf der Brust. Außerdem ist jeder Teilnehmer für sein Wohlbefinden selbstverantwortlich und kann jederzeit eine Pause einlegen, aus der Übung rausgehen oder auch aussetzen. Möchte jemand an einer Körperstelle nicht von jemanden berührt werden, kann er das äußern, natürlich ohne den anderen dabei zu verletzten. Und der andere hat das zu respektieren. Es geht darum, die eigenen Grenzen zu spüren, sie einzuhalten und das auch von anderen einzufordern. Beim professionellen Kuscheln gibt es Bereiche, die tabu sind. Foto: pixabay Jetzt geht es ab nach oben in das ehemalige Kinderzimmer der Tochter. Dort ist schon alles vorbereitet. Matratzen und Kissen liegen verteilt auf dem Boden. Nun beginnen Peter und Imke mit ihrem eigentlichen Programm. Zunächst lernen sich die Gäste in kleinen Gesprächsgruppen noch näher kennen. Zum netten Plausch kommen leichte Berührungen der Hände und Finger hinzu, wer möchte, kann sich kurz umarmen. Auch Umarmungen mit nur einem Partner sind erlaubt. Foto: pixabay Es folgen die „Wünsch-dir-was“- oder die Schnecken-Übung. Imke und Peter wechseln ihr Programm von Mal zu Mal ab, wandeln es um, ändern die Reihenfolge der Übungen. Schließlich soll keine Langeweile aufkommen - es kann ja sein, dass man wiederkommen möchte. Jede Party endet mit freiem Kuscheln, zu zweit mit dem Partner seiner Wahl oder auch in der gesamten Gruppe wie ein Welpenhaufen. „Das ist ein besonders intensives Erlebnis.“ Und dann sind die vier Stunden auch schon wieder vorüber. Was hat sich verändert? „Die Gäste sind viel entspannter. Sie gehen immer zufrieden und mit einem Lächeln“, sagt Imke. Nach der Kuschelparty sind die meisten Gäste völlig entspannt. Foto: pixabay Grund dafür ist das Kuschelhormon Oxytocin, das bei Berührungen frei wird. Höchstwahrscheinlich sind die Teilnehmer mitunter auch froh, sich auf die Kuschelparty eingelassen zu haben und stolz auf sich, nicht gegangen zu sein. Ein Hoch auf den Mut und die Kuschelpartys! http://www.kuscheln4you.de/ |